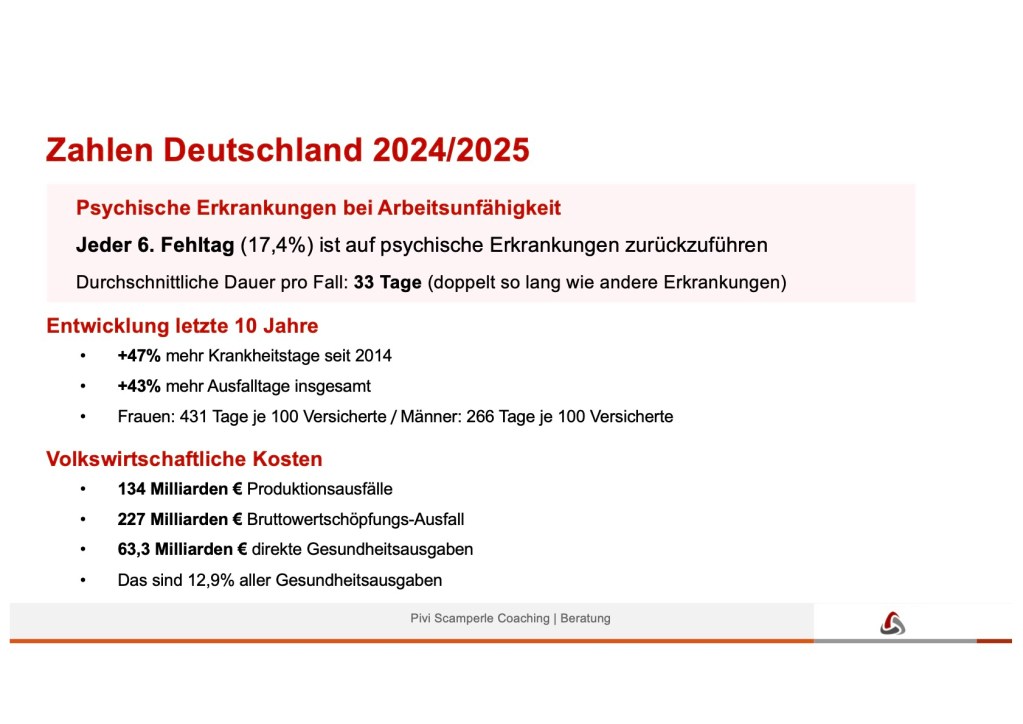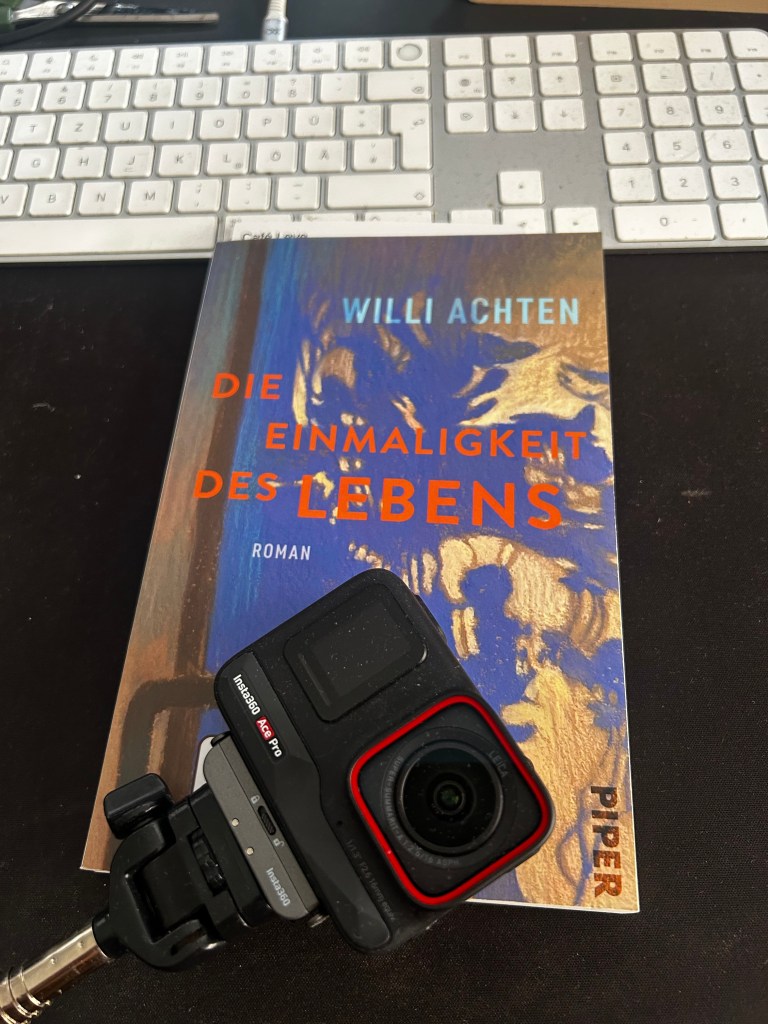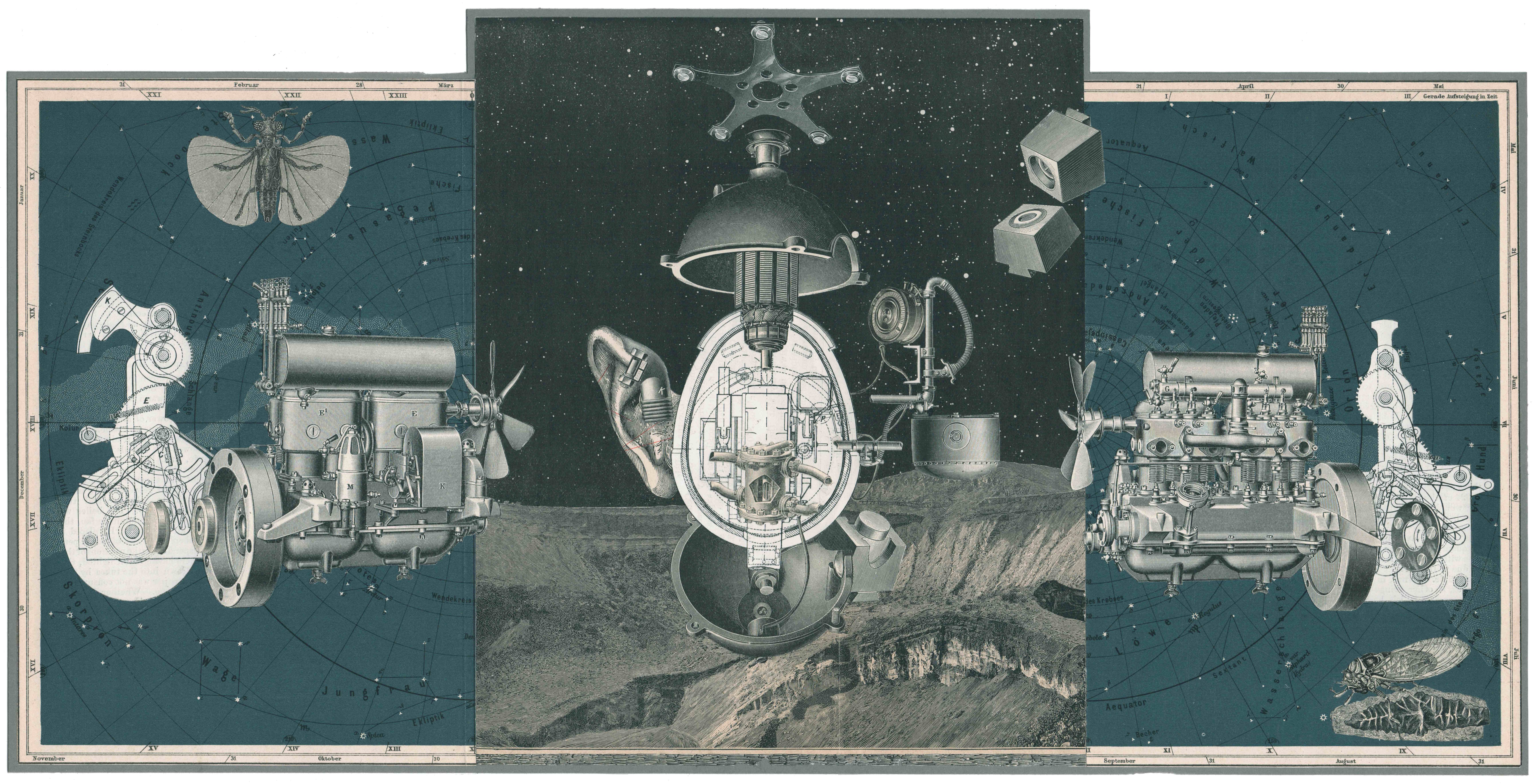JUPITER heißt der Rechner, und schon der Name klingt nach einer Epoche, die sich ihre Götter wieder aus Apparaten baut. Vor solchen Maschinen steht eine Gesellschaft gern mit jenem staunenden Gesicht, das früher Kathedralen galt. Man sieht auf Rechenleistung und meint Zukunft. Man blickt auf Kühlkreisläufe, Chips, Datenströme und verwechselt Kapazität mit Richtung. Genau in diesem Missverständnis liegt die heimliche Brisanz von Manfred Ronzheimers taz-Text über das neue Papier des Wissenschaftsrats. Denn sein Gegenstand ist nicht einfach Wissenschaftspolitik. Sein Gegenstand ist die viel grundsätzlichere Frage, ob eine Gesellschaft, die alles vermessen kann, überhaupt noch weiß, wohin sie will.
Ronzheimer ist dort am besten, wo er nicht referiert, sondern den Riss zeigt. Der Wissenschaftsrat, dieses in Deutschland eigentümlich nüchterne Beratungsgremium, wagt den Blick bis 2040 und entwirft nicht eine Zukunft, sondern vier. Das allein ist in einem Land bemerkenswert, das seine Horizonte gern in Förderperioden, Legislaturen und Antragslogiken portioniert. Noch bemerkenswerter aber ist, dass diese Zukunftsbilder nicht beruhigen. Sie sind keine Fortschrittsprospekte. Sie sind Versuchsanordnungen, in denen sichtbar wird, was aus Wissenschaft werden kann, wenn man sie entweder überhöht, globalisiert, situativ zerreibt oder ökonomisch instrumentalisiert.
Vier Szenarien und ein Ausfall
In der „Wissenschaftsrepublik“ wächst die Macht des Systems, und mit ihr wachsen die Spannungen im Land. Im „globalen Forschungsraum“ expandiert die Forschung international, während KI die Zahl der Forschenden sinken lässt. Die „situative Wissenschaftspolitik“ macht aus Wissenschaft eine Dauerverhandlung, deren Signatur Unsicherheit ist. Und in der „instrumentalisierten Wissenschaft“ haben einige wenige Tech-Konzerne nicht nur Daten, sondern auch das Vorwissen darüber monopolisiert, welche Forschung Rendite verspricht und welche verschwindet. Das ist der eigentliche Schrecken der Gegenwart: Nicht das Verbot, sondern die Vorselektion; nicht der offene Angriff auf Erkenntnis, sondern ihre lautlose Sortierung nach Verwertbarkeit.
Ronzheimer erkennt, dass der Text des Wissenschaftsrats genau an dieser Stelle spannend wird. Er begreift, dass Szenarien nur auf den ersten Blick technokratisch wirken. In Wahrheit sind sie politische Selbstporträts einer Zeit, die sich vor ihrer eigenen Konsequenz fürchtet. Und deshalb ist der klügste Satz seines Stücks vielleicht gar nicht ausdrücklich formuliert: Nicht die Zukunft steht hier zur Debatte, sondern die Gegenwart, die sich nur noch unter Zukunftsvorbehalt zu artikulieren vermag.
Der fehlende fünfte Fall
Dann tritt Uwe Schneidewind auf, und mit ihm ändert sich der Ton. Er lobt den Szenarienansatz des Wissenschaftsrats ausdrücklich, aber er stört die Architektur des Papiers durch eine Frage, die man in Berlin ungern hört, weil sie nicht nach Steuerung klingt, sondern nach tektonischer Verschiebung. Warum, fragt er sinngemäß, fehlt das eigentlich radikale Szenario: ein umfassender integrierter Wissenserwerb bei vollständigem Bedeutungsverlust der Präsenzuniversität? Die Formulierung ist so präzise wie beunruhigend. Denn plötzlich geht es nicht mehr um Reformen des Bestehenden, sondern um die Möglichkeit, dass die Institution selbst historisch werden könnte.
Schneidewind denkt den Befund zu Ende. Wenn Qualifizierung und Wissensaufbau immer unmittelbarer an die Orte der Verwertung wandern, wenn duale Studiengänge anschwellen, wenn Unternehmensforschungszentren staatliche Einrichtungen überflügeln und akademische Einzelstars Hochschulen nur noch als Reputationskulisse benötigen, dann verändert sich nicht nur der Betrieb. Dann verändert sich die Gestalt des Wissens. Ronzheimer greift diese Zuspitzung mit Recht auf, weil in ihr die ganze Fragilität des Systems aufscheint: Hochschulen könnten zu jenen Gebäuden werden, die man umnutzt, sobald der Glaube an ihre zentrale gesellschaftliche Funktion erlischt. Wie Kirchen in einer säkularisierten Welt. Das Bild ist brutal, gerade deshalb bleibt es haften.
Das Missverständnis der Gegenwart
Nun läge es nahe, diese Diagnose als kulturpessimistische Übertreibung zu lesen. Genau dagegen hilft der Blick in den Band „König von Deutschland“ von Lutz Becker und mir, genauer: in das Gespräch mit Uwe Schneidewind, geführt in jener früheren Phase seines Wirkens, als er Präsident des Wuppertal Instituts war und noch nicht in das Wuppertaler Rathaus gewechselt hatte. Dort spricht keiner im Ton des Alarmisten. Dort wird vielmehr das Grundproblem freigelegt, das unter Ronzheimers Text und unter dem Papier des Wissenschaftsrats gleichermaßen liegt: die Austrocknung des normativen Denkens in den Wissenschaften selbst.
Schneidewinds schärfste Formel lautet, die Ökonomie sei zur Bestandswissenschaft geworden und habe darüber verlernt, Gestaltungswissenschaft zu sein. Dieser Satz trifft nicht nur die Wirtschaftswissenschaft. Er trifft das Selbstverständnis einer akademischen Kultur, die ihre Begriffe von Exaktheit, Modellierung und Evidenz so lange verfeinert hat, bis sie den Zweck ihres Tuns aus dem Blick verlor. Was einmal von der Frage ausging, wie sich für viele Menschen ein besseres Leben organisieren ließe, endet als Legitimationsbetrieb des Vorhandenen. Thomas Morus, Adam Smith, die frühen großen Entwürfe — sie alle waren, bei allen Unterschieden, von einer normativen Energie getrieben. Die Gegenwart hat diese Energie gegen methodische Selbstberuhigung eingetauscht.

Der eigentliche Gehalt des Königs
Gerade deshalb ist der Titel „König von Deutschland“ viel besser, als er auf den ersten Blick klingt. Er ist kein Spiel mit Allmachtsphantasien und keine Revue ironischer Herrschaftsgesten. Die Figur des Königs ist bei Becker und Sohn eine kontrafaktische Zumutung. Sie fragt: Was würde einer tun, dem unter den Bedingungen dieser Welt reale Gestaltungsmacht zufällt? Nicht als Monarch, sondern als Probe auf Verantwortung. Damit verschiebt das Buch die Debatte weg von der bloßen Beschreibung des Elends und hin zur Frage nach Richtung, Maß, Priorität. Es holt den Entwurf zurück in ein Land, das sich an Verfahren gewöhnt und über Ziele verlernt hat zu sprechen.
Schneidewinds Antwort auf diese Königsfrage ist von einer Nüchternheit, die ihren Ernst gerade daraus bezieht, dass sie jeder Pose misstraut. Wer Macht hat, müsse zuerst die Grundfeste freiheitlich-demokratischer Ordnung sichern, die Würde jedes einzelnen Menschen unangreifbar halten und dafür sorgen, dass Bildung, Gesundheit und Grundversorgung nicht zu Luxusgütern werden. Erst dann beginne die eigentliche Gestaltung. Das ist deshalb so bemerkenswert, weil hier Wissenschaft nicht als Expertokratie gedacht wird, sondern als Schutzraum für die Kraft des besseren Arguments. Mit einem Mal erscheint Wissenschaftspolitik nicht mehr als Ressortfrage, sondern als Frage der republikanischen Infrastruktur.
Nicht rechnen, sondern urteilen
Noch wichtiger ist, was Schneidewind über den Zustand der Disziplinen sagt. Seine Kritik an der modernen Ökonomie richtet sich nicht gegen Mathematik, sondern gegen die Vergötzung jener Form von Kontrolle, die Mathematik suggeriert. Er beschreibt die psychologische Faszination eines Faches, das einen hochkomplexen Gegenstand durch Modellierung scheinbar in den Griff bekommt — und das auf Kritik deshalb nicht bloß sachlich, sondern identitär reagiert. Genau an dieser Stelle kippt Wissenschaft leicht in einen hierarchischen Habitus: Wer rechnen kann, gilt mehr; wer nur mit Worten argumentiert, weniger. Wer ein komplexes Modell beherrscht, steht über dem, der Zusammenhänge historisch, sozial oder philosophisch ausleuchtet. So entstehen Inseln des Wissens, aber keine Orientierung.
Was Schneidewind dagegen setzt, ist kein anti-intellektuelles Programm der Auflösung, sondern eine anspruchsvollere Idee von Wissenschaft: pluraler in den Methoden, historischer im Selbstverständnis, offener für andere Disziplinen, mutiger im Experiment. Er spricht von Transdisziplinarität, von Realexperimenten, von einer Wissenschaft, die an den realen Problemen der Menschen ansetzt und ihre Fragen auf Augenhöhe formuliert. Berühmt ist in diesem Gespräch die Wendung, man dürfe die Welt nicht am grünen Tisch retten wollen; am Ende müsse man sie mit den Menschen zusammen retten. Das ist der Satz, der den ganzen Unterschied markiert zwischen einer Wissenschaft, die Anwendung simuliert, und einer Wissenschaft, die Wirklichkeit berührt.
Die Rückkehr der Zwecke
Von hier aus liest sich Ronzheimers taz-Text mit einem Mal schärfer. Denn dann wird deutlich, dass der Wissenschaftsrat zwar Szenarien entwirft, die eigentliche intellektuelle Arbeit aber erst dort beginnt, wo man wieder über Zwecke spricht. Wozu Wissenschaft? Wozu Universität? Wozu Innovation? Das sind keine Sonntagsfragen. Es sind die Kernfragen einer Gesellschaft, die Gefahr läuft, ihre leistungsfähigsten Institutionen in Apparate ohne Selbstbegründung zu verwandeln. Der Supercomputer kann rechnen, ob ein Vorhaben effizient ist. Er kann nicht sagen, warum es sinnvoll ist. Genau deshalb reicht Zukunftsforschung nicht aus. Es braucht Zukunftsurteil.
Vielleicht ist das die eigentliche Leistung des Gesprächs im König von Deutschland-Band: Es führt die Wissenschaft aus der Komfortzone ihrer Verfahren zurück in die Unruhe ihrer Legitimation. Es erinnert daran, dass Utopie kein peinlicher Restbestand aus naiven Zeiten ist, sondern die Bedingung dafür, dass Wissenschaft überhaupt noch an den gesellschaftlich relevanten Fragen sensibel wird. Eine utopiefreie Wissenschaft, sagt Schneidewind sinngemäß, wird eng, selbstreferenziell, reputationsfixiert. Sie arbeitet dann mit Datenbeständen, weil sie sich gut auswerten lassen, nicht weil die Welt darin zur Sprache käme. Spätestens an diesem Punkt ist man nicht mehr bei Hochschulpolitik. Man ist bei einer Zivilisationsfrage.
So gesehen erzählt Ronzheimers Text von mehr als vier Zukunftsszenarien. Er erzählt von einem Land, das ahnt, dass seine Wissenschaft in einen Entscheidungsmoment geraten ist. Und Schneidewinds Einspruch erzählt davon, dass diese Entscheidung nicht durch noch mehr Optimierung zu gewinnen sein wird. Die Frage lautet nicht, wie man das System effizienter macht. Die Frage lautet, ob man ihm seinen Grund zurückgeben kann.Nicht mehr Forschung allein. Nicht mehr Transfer allein. Nicht mehr Technologie allein. Sondern Urteil.
Und vielleicht beginnt jede ernsthafte Wissenschaftspolitik genau dort: in dem Augenblick, in dem sie sich nicht mehr mit der Verwaltung ihrer Mittel verwechselt, sondern wieder den Mut findet, ihre Zwecke auszusprechen.